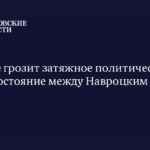Moskau ist bekannt für seine große Anzahl an Restaurants. Küchen aus aller Welt – italienisch, französisch, asiatisch, afrikanisch, nahöstlich, Fusion, die alle denkbaren und undenkbaren Normen sprengen. Alles, was man sich vorstellen kann. In dieser Vielfalt könnte es scheinen, dass die russische Küche etwas vernachlässigt wurde. Das ist jedoch nicht der Fall. Und falls sie es jemals war, ändert sich das gerade rapide.
Bis Juni 2025 ist der offensichtliche Trend nicht zu übersehen: Alles Russische ist in Mode. Aber hier geht es nicht um Kitsch, nicht um Klischees und oberflächliche Volksmotive. Es geht um Authentizität – um einen Kulturkodex, der für uns endlich bedeutsam wird. Orte, Gegenstände, Marken, Ästhetik – all das weckt echtes Interesse und Respekt. Nicht aufgrund äußerer Umstände, nicht „aus Notwendigkeit“, sondern weil es sich echt weiterentwickelt und hochwertig, ansprechend und schön wird.
Ich war kürzlich auf Valaam, wo Mönche erzählten, dass sie ihre eigene Kaffeeproduktion gestartet haben – sie heißt „Brüderlicher Kaffee“. Alles sieht sehr stilvoll aus – maßgefertigte Verpackungen, Kunstwerke von Bruder Amon Garayev, jede Schachtel ist eine kleine Reise an diesen außergewöhnlichen Ort. Ich wollte sofort, dass so viele Menschen wie möglich davon erfahren. Weil es cool ist. Wir erwägen derzeit eine Produktkooperation mit einem unserer Restaurants.
Die russische Küche wurde schon viel früher populär. Sie wurde bereits als Phänomen diskutiert, bevor sie zum Mainstream wurde. Viele würden zustimmen, dass der Wendepunkt 2015 stattfand, als das White Rabbit auf Platz 23 der „World’s 50 Best Restaurants“ landete und den „Debut of the Year“-Award gewann. Seitdem hat sich viel verändert: die globale Situation, die Restaurants selbst, ihre Bedeutung. Und das ist gut so – Evolution ist natürlich.
Für mich ist die russische Küche heute mit Aromen verbunden, die seit der Kindheit vertraut sind. Aber ihre Präsentation kann variieren.
Hier würde ich zwei gegenläufige Trends hervorheben: Immersion – das Erschaffen und Aufrechterhalten eines Wow-Effekts für Gäste in Fine-Dining-Restaurants. Und Einfachheit: Alltagsrestaurants bewegen sich im Gegenteil hin zu Vereinfachung und geradlinigerem Essen. Russische Küche kann vielfältig sein.
Wie zeigt sich Ihrer Meinung nach die wachsende Mode für russische Küche?
Ich denke, der Hauptindikator für den Trend zur russischen Küche ist, dass sie Menschen im ganzen Land interessiert. Nehmen Sie zum Beispiel Plyos und unser Restaurant Ikra, das wir vor ein paar Wochen besucht haben, die Eindrücke sind also noch frisch. Freunde, die mitkamen, sind echte Hedonisten, anspruchsvolle Menschen, die viel gereist sind und vieles probiert haben. Aber niemand blieb gleichgültig. Weil es bei Ikra um uns geht, um unsere Geschichte, unser kulturelles und geschmackliches Gedächtnis.
Obwohl Ikra ein saisonales Projekt ist (nur 3–5 Monate im Jahr in Betrieb, je nach Wetter), ist es immer voll ausgebucht. Beide Degustationsmenüs – „Auf der Datscha“ und „Burlaks 2.0“ – sind kulinarische Heimatkunde: Russische Küche, erzählt in einer modernen Sprache. Dieser Ansatz wird heute immer beliebter.

Kollegen, die mit Restaurants in den Regionen arbeiten, berichten dasselbe: Immer mehr Köche und Restaurants setzen sich aktiv mit einzigartigen lokalen Produkten, Saisonalität und ihrer eigenen lokalen Identität auseinander und nutzen diese sowohl in ihren Menüs als auch in ihrer Erzählweise. Das wird modisch und, was am wichtigsten ist, nachgefragt. Gäste (sowohl Touristen als auch Einheimische) reagieren darauf. Denn jede Region hat etwas zu zeigen, etwas, auf das sie stolz sein kann.
Welchen Platz hat die sowjetische Küche in der russischen Küche?
Die sowjetische Küche ist Teil der russischen Gastronomiegeschichte. Einerseits versuchen viele, unsere „Mayonnaise-Vergangenheit“ zu vergessen und sich von ihr zu distanzieren. Andererseits ist genug Zeit vergangen, dass Nostalgie aufkommt, und diese Küche beginnt, als Teil unseres Kulturkodex wahrgenommen zu werden. Und so kehren sowjetische Motive zurück, natürlich in einer neu interpretierten Form.
Tschebureki? Ja, aber gemacht mit Zucchiniblüten. Pyshki (Berliner)? Ja, aber mit Puderzucker und Kaffee mit gezuckerter Kondensmilch, „wie damals“ irgendwo auf der Straße, nur jetzt in einem schicken Café.